Reflexionen zu KI in der Kulturarbeit
Künstliche Intelligenz gilt als Schlüsseltechnologie der Zukunft. In der Kulturarbeit weckt sie Hoffnungen auf Entlastung, Effizienz und kreative Möglichkeiten ebenso wie Befürchtungen über Ressourcenausbeutung und Jobverlust. In der Praxis der freien Szene scheitert es jedoch oft bereits beim Einstieg. Es fehlt an Ressourcen ebenso wie an Orientierung angesichts der Flut an Tools und Möglichkeiten. Nora Soumah, Projektleiterin der Fortbildungsreihe KICK_KI-Community Kultur, mit Einblicken und Tipps zum Einsatz Künstlicher Intelligenz.
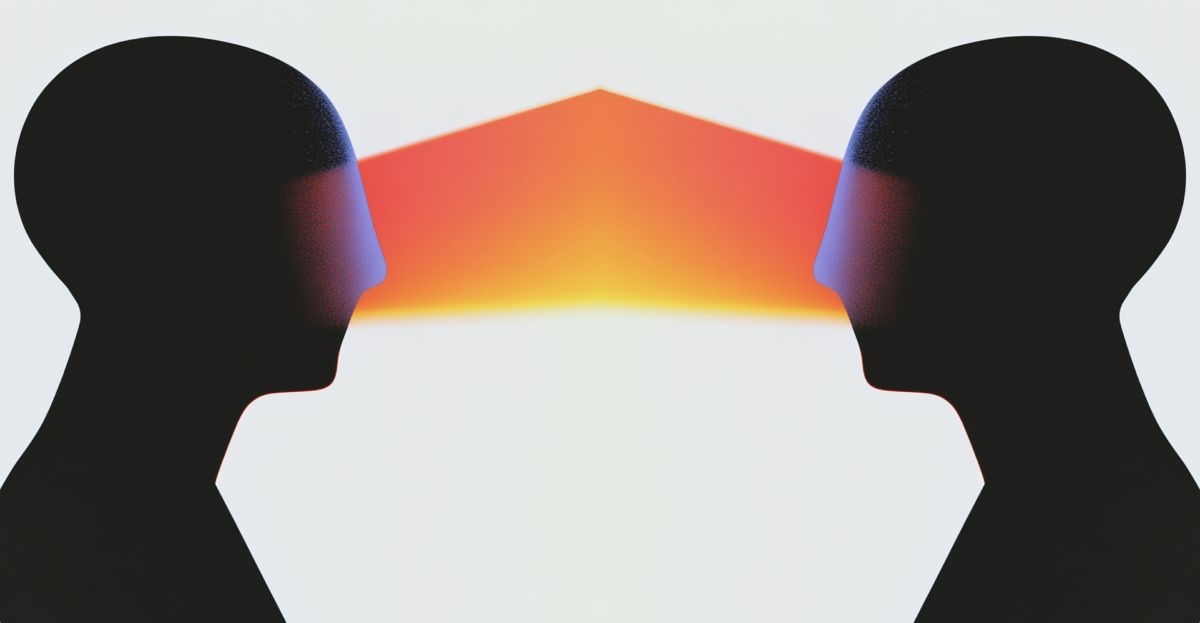
Künstliche Intelligenz ist gekommen, um zu bleiben. Doch während große Institutionen längst Strategien entwickeln und umsetzten, bleibt die freie Szene zumeist Zuschauerin einer digitalen Transformation, die weitgehend (noch) ohne sie geschieht. Für Nora Soumah, Kulturarbeiterin und Leiterin der Fortbildungsreihe KICK_ KI Community Kultur, war das der Ausgangspunkt einer intensiven Auseinandersetzung: Was braucht es, damit KI in der freien Kulturarbeit nicht nur Thema, sondern Werkzeug werden kann?
Der Spagat zwischen Anspruch und Realität
Nur in wenigen Kulturvereinen wird KI aktuell so eingesetzt, dass sie die Arbeit wirklich erleichtert und Prozesse beschleunigt. Das ist kein Zufall, sondern hat gute Gründe. Am Desinteresse liegt es jedenfalls nicht, wie Nora feststellt. Alle Weiterbildungen im Rahmen der Fortbildungsreihe KICK waren ausgebucht, eine Verdreifachung der Programmplätze zu füllen wäre kein Problem – und dies bereits ohne Werbung.
„Aber,“ so Nora, „wenn über digitale Transformation gesprochen wird, wird fast immer nur über Tools, Anwendungen und Ergebnisse gesprochen. Kaum jemand spricht über die Prozesse, Ressourcen und vor allem die Zeit, die benötigt wird, um sie zu lernen.“ Und genau hier liegt das strukturelle Grundproblem: Freie Kulturarbeit ist ein ständiger Spagat zwischen Ehrenamt und prekären Arbeitsbedingungen. Kurzfristige und projektbezogene Förderlogiken erschweren langfristige Planungen und Investitionen. „Das macht einen nachhaltigen Einstieg in die Nutzung von KI fast unmöglich – denn dieser erfordert eine große Eingangsinvestition, die meist nur durch noch mehr zusätzliches freiwilliges Engagement gelingt,“ so Nora.
Das perfide daran ist: KI hätte das Potenzial, die strukturellen Benachteiligungen freier Kulturarbeit zu verkleinern – etwa durch Automatisierung alltäglicher Abläufe, schnelle Analysen von Ideen und Abläufen, Text- und Bildgenerierungen. Ohne Ressourcen für Lernprozesse bleibt der effiziente Einsatz der Technologie jedoch ein Privileg derer, die sich Zeit leisten können – und verstärkt damit bestehende strukturelle Probleme noch, anstatt sie zu verkleinern.
Dass es das Projekt, die Fortbildungsreihe KICK_KI Community Kultur überhaupt gibt, ist Ergebnis eines einmalige Fördercalls des Bundes 2024 zur Digitalen Transformation in Kunst und Kultur. Im Bereich „Ausbildung und Weiterbildung“ wurden damit fünf Projekte mit insgesamt etwas über 150.000 Euro unterstützt. „Ein einmaliger Call reicht klar nicht aus, um die fortlaufende Auseinandersetzung mit einer sich ständigen Wandelnden Technologie sicherzustellen – schon gar nicht in einer Kulturlandschaft, die von Kürzungen betroffen ist.“
Wer digitale Transformation will, muss Lernprozesse finanzieren – nicht nur Outputs. Denn KI kann nur dort wirken, wo Zeit zum Denken bleibt.
Ist Haltung statt Hype überhaupt möglich?
Während der notwendigen Ressourceneinsatz beim Einstieg in die KI-Nutzung kaum Thema ist, ist die Diskussion über ethnische Fragen und gesellschaftlichen wie ökologischen Auswirkungen von KI omnipräsent. Auch so im Rahmen der bisherigen KICK Veranstaltungen. Abschließende Antworten darauf sind kaum möglich, jedoch ein Praxisrat:
„Mein wichtigster Tipp für Kulturvereine, die KI nutzen wollen, wäre zuerst zu klären: Was will ich mit KI tun? Und dann wie will ich es tun? Also aufbauend auf klar definierte Leitlinien und Werte den Prozess Schritt für Schritt zu entwickeln,“ so Nora rückblickend zu ihren Erkenntnissen zum bisherigen Fortbildungsreihe. Diese Herangehensweise betrifft vor allem den „technischen“ Teil: Automatisierung, Übersetzung, Textkürzung, Transkription.
Die spannendsten Momente entstehen dann, wenn KI nicht als Maschine, sondern als Spiegel genutzt wird – um die eigene Arbeit, Sprache und Perspektive zu reflektieren.
Ein viel spannenderer Aspekt als die Automatisierungen ist jedoch – und dies waren auch jene, wo laut Nora die die größten „Aha-Momente“ vieler Teilnehmender waren – die Analysefähigkeit riesiger Datenmengen in Sekunden. Dadurch lassen sich ´Reflexionsräume öffnen und erweitern. Ein Beispiel: „Ich habe ein Projekt, das ich seit Jahren umsetze. Mit KI kann ich es an einem Nachmittag in Hinblick auf Theorien wie intersektionale Diskriminierung, eurozentrische Sichtweisen oder Exklusion reflektieren – ohne Expert*innen, ohne tagelange Recherche. Oder ich kann meinen Förderantrag aus Sicht einer Jury oder Förderstelle prüfen lassen. KI kann jede Rolle einnehmen, zu der es Informationen gibt – und da viele Tools mittlerweile Quellen verlinken, lassen sich die Ergebnisse auch überprüfen.“
Der Einsatz von KI verlangt Haltung: eine bewusste Auseinandersetzung mit Ethik, Verantwortung und den Werten, auf denen die eigene Kulturarbeit basiert.
Dennoch: Trotz aller Intelligenz – auch die KI macht Fehler. Die Frage nach dem „Wie“ mit KI arbeiten bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Insbesondere die Reflexionsfähigkeit, Perspektivwechsel oder das Feedback durch KI braucht präzise Vorgaben durch die Kulturvereine: Welche Haltung haben wir? Was ist unsere Organisationsethik? Welche Werte leiten unsere Arbeit? „Denn,“ so Nora erinnernd, „KI ist nicht neutral – sie reproduziert die neoliberale Welt, in der wir leben. Das heißt wir müssen bewusst gegensteuern und uns unserer Verantwortung klar sein“. Und diese Haltung in Leitlinien zum Einsatz von KI zu erarbeiten und die KI darin zu trainieren und stets in ihrer Arbeit zu überprüfen, benötigt wiederrum Zeit.
Was ist also das Zwischenfazit nach einem halben Jahr Projekt KICK_KI Community Kultur? „Das Erlernen und Trainieren von KI-Systemen braucht deutlich mehr Zeit, als der einfache Zugang vermuten lässt. Eigentlich braucht es nur einen Klick – und man kann mit der KI interagieren. Die Tools und Anwendungen werden jedenfalls täglich mehr. Umso wichtiger ist, sich der eigenen Verantwortung und Haltung bewusst zu sein, auf individueller wie politischer Ebene: Das heißt, den rechtlichen Rahmen eng zu halten – im Sinne europäischer und demokratischer Werte – und gleichzeitig Lernprozesse sowie Zeit für Reflexion zu fördern, auch in der freien Kulturarbeit.
Trotz all dieser Herausforderungen sehe ich KI nicht als Bedrohung für die freie Kulturarbeit, sondern als Erweiterung – als Spiegel menschlicher Kreativität, Ambivalenz und Verantwortung. Die Frage ist nicht, ob wir KI nutzen – sondern wie wir mit ihr weiter Denken lernen.“
Weitere Module & Termine
im Rahmen der KICK_ KI Community Kultur Fortbildungsreihe:
KI Webinar #11 – Leitlinien für einen verantwortungsvollen KI-Einsatz in Kulturvereinen:
Donnerstag, 20.11.2025 14:00 – 15:30 Uhr
mit DI Ronald Hechenberger, MBA
⇒ Details und Anmeldung
Community Lab #2 – Mit KI weiterdenken – Impulse für kreative und solidarische Kulturarbeit:
Dienstag, 28.10.2025 13:00 – 14:30 Uhr
mit Eva Fischer
⇒ Details und Anmeldung
Community Lab #3 – Diskriminierung und Macht:
Dienstag, 25.11.2025 13:00 – 14:30 Uhr
mit Allapopp
Community Lab #4 – Hoffnung, Hype oder Risiko? lnspirationen aus dem Comic Essay Schokorohoter und Deepfakes:
Dienstag, 16.12.2025 13:00 – 14:30 Uhr
mit Dr. Julia Schneider
Community Lab #5 – tba.
Dienstag, 27.11.2025 13:00 – 14:30 Uhr
Ressourcen und Details zur Fortbildungsreihe KICK_ KI Community sind auf der Projektseite zu finden.
Immer informiert: In unserem KI-Newsletter informieren wir über freie Plätze in den Webinaren, Termine der Community Labs und Updates zur Dokumentation und Ressourcen des Projekts. Jetzt anmelden!
